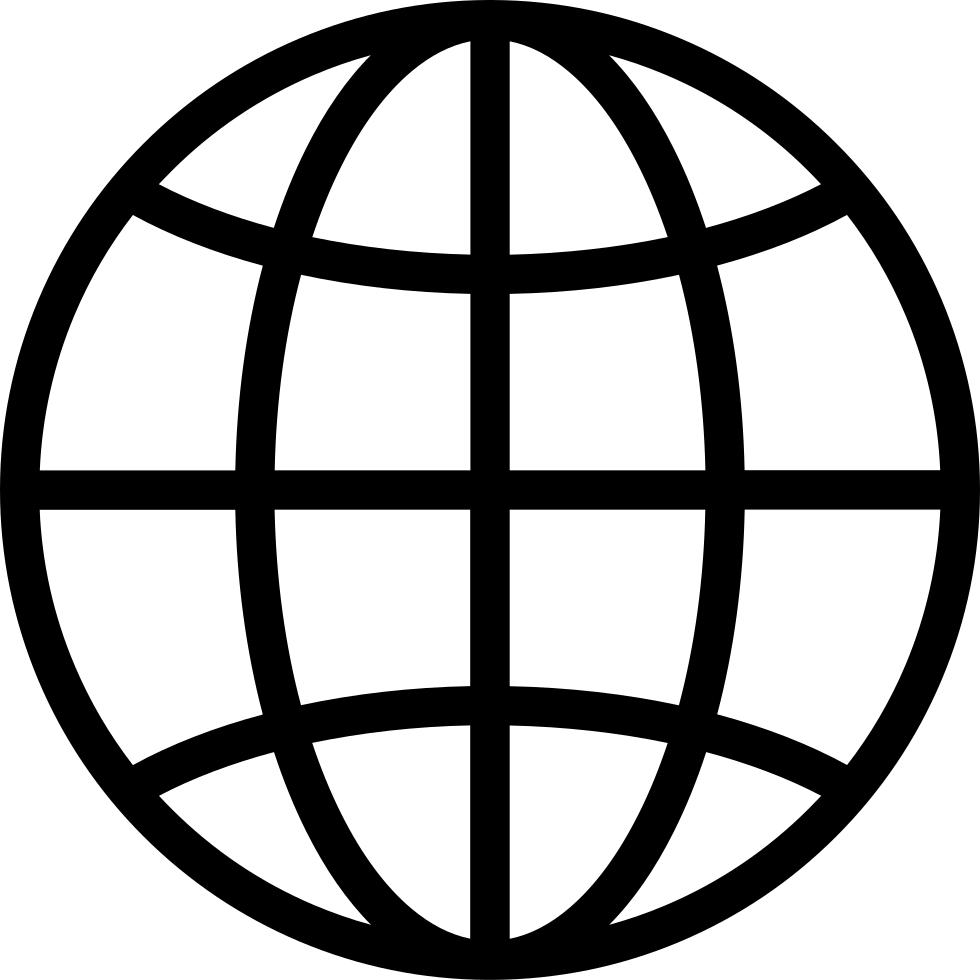Go offline with the Player FM app!
HINTERGRÜNDE NAHOSTKONFLIKT - Die Staatsgründung Israels
Manage episode 417484673 series 2902670
Am 14.05.1948 endet das britische Mandat über Palästina. Noch am gleichen Nachmittag ruft David Ben Gurion den unabhängigen Staat Israel aus. Damit geht der Wunsch vieler Jüdinnen und Juden in Erfüllung, nach den letzten Jahrzehnten der Verfolgung und Ermordung zurückkehren zu können nach Zion, dem "Land der Väter". Der Weg von der Idee Theodor Herzls, in Palästina eine "Heimstätte" für das jüdische Volk zu schaffen, bis zum Staat Israel war lang. Von Beginn an war er von Konflikten und Interessenskollisionen bestimmt. Von Ulrike Beck (BR 2018)
Credits
Autorin: Ulrike Beck
Regie: Sabine Kienhöfer
Es sprachen: Hemma Michel, Christian Baumann, Johannes Hitzelberger
Technik: Miriam Böhm
Redaktion: Thomas Morawetz
Im Interview: Prof. Gudrun Krämer, Peter Lintl
Ein besonderer Linktipp der Redaktion:
BR24: Lost in Nahost – Der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza
Der Konflikt im Nahen Osten ist kompliziert. Es ist schwer den Überblick zu behalten. Was werfen die gegnerischen Seiten einander vor? Warum wird so hart gekämpft? In diesem Podcast haben die Korrespondent:innen der ARD aus dem Studio Tel Aviv und Expert:innen aktuelle Fragen beantwortet, erklärt und eingeordnet. ZUM PODCAST
Und hier noch ein paar besondere Tipps für Geschichts-Interessierte:
Im Podcast „TATORT GESCHICHTE“ sprechen die Historiker Niklas Fischer und Hannes Liebrandt über bekannte und weniger bekannte Verbrechen aus der Geschichte. True Crime – und was hat das eigentlich mit uns heute zu tun?
DAS KALENDERBLATT erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum - skurril, anrührend, witzig und oft überraschend.
Und noch viel mehr Geschichtsthemen, aber auch Features zu anderen Wissensbereichen wie Literatur und Musik, Philosophie, Ethik, Religionen, Psychologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Natur und Umwelt gibt es bei RADIOWISSEN.
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de.
Alles Geschichte finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Alles Geschichte
JETZT ENTDECKEN
Timecodes (TC) zu dieser Folge:
TC 00:15 – Intro
TC 02:02 – Der Vater des Zionismus
TC 06:43 – Eine Geschichte jüdischer Zuwanderung
TC 10:07 – Zwischen den Stühlen
TC 12:49 – Ein Ende der Zurückhaltung
TC 15:13 – Die UN und das „Palästinaproblem“
TC 19:36 – (K)eine Lösung?
TC 23:14 – Outro
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
TC 00:15 – Intro
1.O-Ton ( David Ben Gurion - unter dem Text weiterlaufen lassen)
Nicht übersetzt: Proklamation Ben Gurion
Erzähler
Israels erster Ministerpräsident David Ben Gurion ruft am 14. Mai 1948 den unabhängigen Staat Israel aus.
O-Ton aus
Nur wenige Stunden nach dem Ende des britischen Mandats über Palästina. Damit geht für viele Juden der Wunsch in Erfüllung, nach den Jahrzehnten der Verfolgung und Ermordung nun nach Zion, in das „Land der Väter“ zurückkehren zu können.
MUSIK
Erzählerin
Die Sehnsucht nach einer Rückkehr ins „verheißene Land“ ist nicht neu. Sie ist so alt wie das fast zweitausendjährige Exil nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem 70 n. Chr. und der Vertreibung der Juden aus Palästina. Die Idee, in Eretz Israel, dem "Land Israel" einen israelischen Staat zu gründen, ist allerdings noch jung.
Erzähler
Sie entsteht Ende des 19.Jahrhunderts mit dem Aufkommen des Zionismus. Was darunter zu verstehen ist, erklärt die Historikerin und Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer:
MUSIK aus
2.O-Ton: (Krämer ab 0:01)
Im weitesten Sinne die Sehnsucht nach Zion. Ein Alternativbegriff zu Jerusalem. Das kann religiös und kulturell sein. Es kann sich aber auch politisch zuspitzen. Ist dann eine Ausprägung des Nationalismus, wie er sich im 19.Jahrhundert in ganz vielen Formen herausbildete. Und beschreibt im konkreten Fall den jüdischen Nationalismus, der davon ausgeht, dass die Juden nicht nur eine religiöse Gemeinschaft sind, sondern auch eine politische und als solche auch den Anspruch besitzen, den andere Völker haben: die Bildung eines eigenen Staates.
TC 02:02 – Der Vater des Zionismus
MUSIK
Erzählerin
Als Vater des politischen Zionismus gilt Theodor Herzl. Ein jüdischer Intellektueller aus Wien, der ab 1891 als Korrespondent für die Zeitung „Neue Freie Presse“ in Paris arbeitet. Unter dem Eindruck der Affäre um Alfred Dreyfus, der als Hauptmann jüdischer Herkunft wegen angeblicher Militärspionage verbannt wird und zwei Jahre später trotz erwiesener Unschuld verurteilt bleibt, besteht für Herzl Handlungsbedarf.
Erzähler
Als Antwort auf den wachsenden Antisemitismus schreibt Herzl sein Buch „Der Judenstaat“, das zum Manifest für die Selbstbestimmung in einer eigenen Nation werden soll. Darin heißt es:
MUSIK aus
Zitator: (Herzl S. 4)
„Ich halte die Judenfrage weder für eine soziale, noch für eine religiöse. Sie ist eine nationale Frage und um sie zu lösen, müssen wir sie zu einer politischen Weltfrage machen, die im Rate der Kulturvölker zu regeln sein wird.“
MUSIK
Erzählerin
Die von Herzl angesprochene „Judenfrage“ ist spätestens seit 1881 - nach dem Attentat auf den russischen Zaren Alexander II. - von existentieller Wichtigkeit. Obwohl die Täter der extremistischen Organisation „Narodnaja Wolja“, übersetzt „Volkswille“, angehören, wird die Schuld zunächst „den“ Juden angelastet. In der Folge kommt es bereits ab 1881 zu einer ersten Welle von Pogromen in Russland und in Polen. Wie mit dieser Situation umgehen? Der Politikwissenschaftler Peter Lintl:
MUSIK aus
3.O-Ton (Lintl ab 1:03)
Für die Genese des Zionismus (…) ganz zentral ist sicherlich der europäische Antisemitismus und die Frage - was in Europa als die sogenannte „jüdische Frage“ bezeichnet wird. Nämlich: Was soll man mit den Juden in Europa machen? Darauf gab es im Judentum auch unterschiedliche Antworten. Zum einen in West- und Zentraleuropa den Versuch, sich zu integrieren und zu akkulturieren, manchmal auch zu assimilieren, d.h. durch größtmögliche Anpassung die Judenfeindschaft zurückzudrängen. In Osteuropa war es eher das Anhängen an der Tradition. (…) da herrschte auch die Hoffnung vor, dass einfach durch Gottvertrauen der Antisemitismus als Phänomen in der Geschichte vorbei gehen würde. Der Zionismus hingegen sagt: Nein, die jüdische Frage kann nicht in Europa gelöst werden, sondern wir müssen unser Schicksal in unsere eigenen Hände nehmen und wir müssen unseren eigenen Staat gründen.
Erzähler
„Der Judenstaat“ erscheint am 14.Februar 1896 in Wien und wird in 18 Sprachen übersetzt. Darin entwirft Theodor Herzl ein Programm, wie es gelingen kann, einen Staat für das jüdische Volk zu schaffen. Als künftige Landessprache erscheint ihm Deutsch geeigneter, als das alttestamentarische Hebräisch. Als passenden Ort favorisiert er neben Palästina auch Argentinien. Gudrun Krämer:
4.O-Ton: (Krämer ab 0:56)
Theodor Herzl war ein bürgerlicher Aktivist. Ein Journalist, der in ganz rechtlichen Bahnen dachte und als Voraussetzung für den Erfolg annahm, dass die (…) führenden europäischen Länder, bzw. Staaten plus die USA diese Idee eines jüdischen Staates unterstützen müssten. So dass hier nicht quasi wild Kolonien und Siedlungen errichtet würden, sondern dass von vornherein eine internationale Gemeinschaft hinter diesem Plan stünde und darauf dringen könnte, in Eretz Israel, also Palästina, oder auch an anderem Orte, einen wohlgeordneten jüdischen Staat entstehen zu lassen.
Erzählerin
Am 3.September 1897 gründet sich auf Initiative Herzls die Zionistische Weltorganisation. Auf ihrem ersten Kongress in Basel verabschiedet die ZWO ihr Grundsatzprogramm. Mit dem zentralen Ziel der „Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina“. Jetzt war also klar - es sollte um Palästina gehen.
Erzähler
Doch um dieses Ziel zu erreichen, braucht Theodor Herzl als Präsident der Zionistischen Weltorganisation Unterstützung. Was angesichts des wachsenden Antisemitismus in Europa ein Problem ist. Gudrun Krämer:
5.O-Ton:
Er hatte nicht die Unterstützung der Regierungen, wie viele Teile auch der jüdischen Bevölkerung dieser Idee sehr skeptisch gegenüber standen, nicht so recht sehen konnten, wohin die Reise gehen würde. Er hatte Zuspruch unter jüdischen Gemeinschaften in Osteuropa, obwohl er selber ausgesprochen westeuropäischer Jude war und sich auch in erster Linie an die westeuropäischen jüdischen und nichtjüdischen Eliten richtete. Aber der Druck auf Juden war in Osteuropa stärker als in Westeuropa und daher auch die Zustimmung in jener Zeit der noch recht unspezifischen Idee eines jüdischen Staates.
TC 06:43 – Eine Geschichte jüdischer Zuwanderung
MUSIK
Erzählerin
Die ersten jüdischen Zuwanderer kommen bereits 1882 nach Palästina. Es sind rund 30.000 osteuropäische Juden, die vor allem wegen der antisemitischen Übergriffe in Russland und Polen auswandern. Sie kommen in ein Land, das damals Teil des Osmanischen Reiches ist:
MUSIK aus
Palästina.
MUSIK
Erzähler
Das Land ist keineswegs unbewohnt. 350.000 Menschen leben hier. Die überwiegende Mehrheit sind Araber sunnitisch-muslimischen Glaubens. Neben ihnen gibt es auch eine große christliche Gemeinschaft und gläubige Juden.
AKZENT Glockengeläut Muezzin
Erzählerin
Die Bewohner Palästinas sind Ende des 19.Jahrhunderts vor allem im Süden des Landes sesshaft. Die meisten von ihnen sind Bauern.
Erzähler
In den Städten leben Handwerker, Kaufleute, Unternehmer und die lokale Oberschicht, Notabeln genannt. Außer der Hauptstadt Jerusalem sind vor allem die Hafenstädte Haifa und Jaffa bedeutend, ebenso wie die Bergstadt Nablus.
MUSIK
Erzählerin
Für die Bewohner Palästinas ändert sich mit den neuen Zuwanderern viel. Denn mit der sogenannten zweiten Alija, der zweiten Einwanderungswelle kommen ab 1903 rund 40.000 weitere jüdische Einwanderer, die vor den erneuten Pogromen in Russland und Polen fliehen. Und sich daran machen, auf dem Land Boden zu kaufen, um dort nach sozialistischem Vorbild in Produktionsgemeinschaften Landwirtschaft zu betreiben. Peter Lintl:
6.O-Ton:
Insbesondere die zweite und die dritte Alija war sozialistisch geprägt. Das sieht man nicht nur an den Kibbuzim und Mosharim, also basisdemokratischen Kollektiven, die quasi ohne individuelles Eigentum oder mit sehr wenig individuellem Eigentum auskamen, aber vielmehr sieht man das auch noch in den Idealen, die die zionistische Bewegung der Zeit prägten. Also da war das Ideal des unabhängigen, heroischen Pioniers, des Haluts, des neuen Hebräers, der sein Land - Eretz Israel - bearbeitet und sich damit auch zu eigen macht. Das drückt sich z.B. sehr deutlich in der Formel „Erlösung des Landes durch die Eroberung des Bodens“ aus. Dazu kommt auch das Prinzip der hebräischen Arbeit. Man wollte unabhängig sein von arabischen Arbeitern und wollte alles selbst erarbeiten.
Erzähler
Die jüdischen Zuwanderer verwenden moderne Technologien, um den Boden zu bearbeiten und zu bewässern. Sie bauen Zitrusfrüchte an, die für den Export bestimmt sind. Die meisten von ihnen leben allerdings nicht auf dem Land, sondern lassen sich in den Städten nieder. Sie brauchen Platz. 1909 entsteht neben der alten Hafenstadt Jaffa die heutige Millionenmetropole Tel Aviv.
Erzählerin
Schon bald beginnen die jüdischen Bewohner Palästinas sich zu organisieren. Sie gründen nicht nur Vereine, Verbände und Clubs, sondern errichten auch Bibliotheken und das Technion in Haifa - die erste Universität.
Mit Gründung der Gewerkschaftsorganisation Histadrud schaffen sie sich einen eigenen Arbeitsmarkt. Und organisieren zum Schutz ihrer Siedlungen Wächter, die Schomreen.
Erzähler
Zwischen der arabischen Bevölkerung und den jüdischen Zuwanderern bilden sich in dem kleinen Land Parallelgesellschaften heraus.
MUSIK
TC 10:07 – Zwischen den Stühlen
Erzählerin
Bis 1917 steht Palästina unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches. Doch gegen die Osmanen formiert sich schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts die nationalarabische Bewegung. Ihr Ziel ist ein unabhängiges Vereinigtes Arabisches Königreich, das neben Palästina auch Syrien, den Libanon und Jordanien umfassen soll.
Erzähler
Ein Plan, der nicht aufgeht, denn im Ersten Weltkrieg erhöht sich der Stellenwert Palästinas für die europäischen Großmächte.
MUSIK aus
Großbritannien erobert das Land und erhält 1922 das Mandat über Palästina. Peter Lintl:
7.O-Ton
Zunächst ist für Großbritannien Palästina strategisch wichtig. Der Zugang zum Suezkanal ist eine Sache. Ist ein Teil der Landbrücke nach Indien und alle Wege nach Indien sind für das britische Empire zur Zeit des Kolonialismus einfach zentral. In Palästina wird Großbritannien tatsächlich vor eine Herausforderung gestellt, weil es klar ist, dass es zwei verschiedenen Interessen gerecht werden muss. Einmal der palästinensischen Seite, die dort einen Staat errichten will.
Zumindest im Laufe der Zeit kristallisiert sich der palästinensische Nationalismus immer klarer heraus. Und auf der anderen Seite dem Zionismus, der das ähnliche Ziel hat oder das nämliche. Deswegen spricht man von der doppelten Verpflichtung der Briten, der dual Obligation, die sie zu erfüllen hat.
Erzählerin
Schon rund fünf Jahre zuvor, am 2.November 1917, schreibt der britische Außenminister Lord Arthur Balfour an den Vorsitzenden der Zionistischen Vereinigung in England einen Brief, der als „Balfour-Erklärung“ von zentraler Bedeutung sein wird. Darin verspricht Balfour Lord Lionel Walter Rothschild:
Zitator:
"Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei, wohlverstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte."
8.O-Ton: ( Krämer ab ca. 15:15)
Dieses Versprechen, das zunächst keine völkerrechtlich bindende Funktion hatte, wurde in den Mandatsvertrag übernommen, bzw. in dessen Präambel und erhielt dadurch ein ganz anderen rechtlichen Status. Hinzu kam aber eine Verpflichtung, die Großbritannien als Mandatsmacht gegenüber der lokalen Bevölkerung - mehrheitlich arabisch - sie bereit zu machen für die Übernahme politischer Verantwortung. In letzter Konsequenz für die Unabhängigkeit. Und wie sich herausstellen sollte, konnte man nicht beiden Seiten gerecht werden.
TC 12:49 – Ein Ende der Zurückhaltung
MUSIK
Erzähler
Ab 1919 kommen mit der dritten und vierten Alija 115.000 jüdische Zuwanderer nach Palästina. Es sind so viele, dass die arabische Bevölkerung befürchtet, bald in der Minderheit zu sein. Es kommt zu ersten blutigen Ausschreitungen, die sich ab 1920 zunächst gegen die Zionisten richten, bald jedoch auch gegen die britischen Mandatsbehörden. Der Konflikt führt dazu, dass sich die jüdischen Einwanderer militarisieren. Die jüdische Armee, die „Hagana“ formiert sich. Peter Lintl:
MUSIK aus
9.O-Ton:
Bis dato war eigentlich das Prinzip der Zurückhaltung - geprägt noch von einem jüdischen Quiezismus noch aus der Exilszeit zu sehen, aber danach mit der weiteren Eskalation des Konflikts kann man sehen, wie sich auch der Zionismus Stück für Stück militarisiert. Grundsätzlich ist natürlich der Konflikt: Wem gehört das Land? Und über diesen Konflikt kommt es zu mehreren Ausbrüchen von Gewalt. Ganz bekannt ist 1920/21, dann 1929 und dann zum größeren palästinensischen Aufstand 1936 bis '39, der dann von den Briten relativ blutig niedergeschlagen wird.
Erzählerin
Um die zunehmende Eskalation der Gewalt zwischen beiden Seiten einzudämmen, machen die britischen Mandatsträger im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges der arabischen Seite Zugeständnisse. Mit dem MacDonald-Weißbuch beschränkt Großbritannien im Mai 1939 die Einwanderung von Juden auf 75.000 für die nächsten fünf Jahre. Gudrun Krämer:
10.O-Ton:
Die Konsequenzen waren von vornherein abzusehen. Die Briten banden die Zahl der Zuwanderer an die Aufnahmefähigkeit des arabischen Sektors - so war die Formulierung, also zunächst einmal an die wirtschaftlichen Möglichkeiten.
Setzten aber noch eins drauf, indem sie auch die politische Willigkeit der arabischen Bevölkerung mit in Rechnung nahmen. Und die Konsequenz war ganz klar, dass dieses die Zuwanderungsmöglichkeit der jüdischen Zuwanderer nach Palästina begrenzte. In einer Zeit, in der durch den Antisemitismus und die Judenverfolgung in großen Teilen Europas der Druck auf die jüdischen Bewohner Europas wuchs, sich eine Alternative zu suchen, also auszuwandern. Darunter auch nach Palästina.
TC 15:13 – Die UN und das „Palästinaproblem“
Erzähler
Bis über das Ende des Zweiten Weltkrieges hinaus versucht der britische Mandatsträger, europäische Juden daran zu hindern, in Palästina einzuwandern. Dennoch ist die Zahl der illegalen Immigranten in der Zeit der NS-Diktatur hoch. Rund 75.000 schaffen es, trotz der restriktiven Politik, nach Palästina zu kommen.
MUSIK
Erzählerin
Als Exempel gegen die illegale Einwanderung wird zwei Jahre nach dem Ende des Holocaust die Odyssee des Schiffes „Exodus“ weltweit bekannt. Das Schiff steuert im Juli 1947 mit über 4.000 jüdischen KZ-Überlebenden an Bord den Hafen von Haifa an. 20 Meilen vor der Küste wird die „Exodus“ von britischen Kriegsschiffen angegriffen. Die Passagiere werden im Hafen auf drei britische Gefängnisschiffe verteilt und nach Frankreich zurückgeschickt.
Erzähler
Dort weigern sie sich, an Land zu gehen. Die Odyssee geht weiter - über Gibraltar nach Hamburg. Wo die jüdischen Flüchtlinge mit Gewalt von Bord geholt und in Lagern untergebracht werden. Gesichert mit Wachtürmen und Stacheldraht.
Unter dem Druck der weltweiten Empörung kommen die Passagiere der „Exodus“ im Oktober 1947 frei.
MUSIK aus
Erzählerin
Schon Monate vor dem Drama der „Exodus“ sieht sich die Mandatsmacht Großbritannien nicht mehr in der Lage, sowohl für den jüdischen, als auch für den arabischen Teil der Bevölkerung in Palästina eine annehmbare Lösung zu finden. Daher beschließt die britische Regierung am 14. Februar 1947, das „Palästinaproblem“ an die Vereinten Nationen zu übergeben.
MUSIK
Erzähler
Damit übernehmen die 1945 gegründeten Vereinten Nationen als Nachfolger des Völkerbundes die Aufgabe, eine Lösung für die politische Zukunft Palästinas zu finden. Sie setzen eine Sonderkommission ein, das „United Nations Special Committee on Palestine“, kurz: UNSCOP.
Erzählerin
Das in seinem Bericht den Plan vorlegt, Palästina zu teilen.
MUSIK aus
In einen jüdischen Staat, bestehend aus 56 Prozent des Territoriums. Und einen arabischen Staat, bestehen aus 43 Prozent des Territoriums. Jerusalem mit seiner zentralen Bedeutung für Juden, Christen und Muslime soll als internationales Gebiet neutral bleiben.
Erzähler
Am 29.November 1947 stimmt die UN-Vollversammlung mit der Resolution 181 dafür, Palästina zu teilen und das britische Mandat aufzuheben.
11.O-Ton ( UN-Vollversammlung)
Erzählerin
Gegen die Resolution stimmen nicht nur Afghanistan, Ägypten, Iran, Irak, Jemen, Libanon und Pakistan, sondern auch Griechenland, Indien und Kuba
MUSIK
Erzähler
Für den Fall der Verwirklichung des Teilungsplanes kündigt die 1945 gegründete Arabische Liga bereits im Vorfeld an, militärische Maßnahmen zu ergreifen und eine „Arabische Befreiungsarmee“ aufzustellen. Unmittelbar nach dem UN-Beschluss kommt es in Palästina zu erbitterten Gefechten zwischen arabischen und jüdischen Militäreinheiten. Am 1. April 1948 beginnt der Plan Dalet. Eine Offensive der Hagana, der jüdischen Armee. Gudrun Krämer:
MUSIK aus
12. O-Ton:
Die Kommission der Vereinten Nationen hatte nach sorgsamer Betrachtung der Realitäten zwei Staaten vorgeschlagen, die jeweils aus nur lose miteinander verknüpften kleinen Territorien bestehen würde. Und hatte dabei der jüdischen Seite dabei mehr Land zugesprochen, als zu dieser Zeit von Juden rechtlich besessen war. Also erworben, gekauft worden war. (…) Das war natürlich konfliktträchtig. Und der Plan Dalet, Plan D., lief nun darauf hinaus, das Land, das die Vereinten Nationen den Juden zugesprochen hatte, auch tatsächlich militärisch zu kontrollieren. Also gewissermaßen im Vorgriff auf die Ausrufung des jüdischen Staates bereits Realitäten zu schaffen. Und dieses war nur möglich durch Anwendung von Gewalt.
TC 19:36 – (K)eine Lösung?
MUSIK
Erzählerin
Im Laufe der Militäroffensive kommt es am 9. April 1948 zum Massaker im arabischen Dorf Deir Yassin, bei dem 250 Menschen ermordet werden.
Die meisten davon sind Frauen und Kinder. Verantwortlich für das Massaker sind die extremistischen Untergrundorganisationen Lehy und Irgun, die damit die arabische Bevölkerung einschüchtern und vertreiben wollen. Peter Lintl:
MUSIK aus
13.O-Ton:
Das Massaker von Deir Yassin wurde verübt von zwei Organisationen und die hatten ganz offensichtlich das Ziel, das Dorf zu säubern. Die Hagana selbst, also die Hauptverteidigungsarmee der Zionisten, hatte damit nichts zu tun und hat dieses Massaker auch verurteilt. Gleichwohl auch die Hagana hat dann in Flugblättern, die dann über Haifa abgeworfen worden sind, Andeutungen gemacht, dass es dieses Massaker gegeben hätte und hat das dann ein Stück weit instrumentalisiert. Sie wollten nicht sagen, dass sie das auch verüben, aber damit Furcht geschürt. Umgekehrt hat der jüdische Bürgermeister von Haifa die Araber, die daraufhin geflohen sind, aufgerufen, hier zu bleiben.
MUSIK
Erzähler
Die radikalen Kampforganisationen „Irgun“ und „Lehi“ verüben auch Attentate gegen britische Verwaltungseinrichtungen und Politiker. Am 22. Juli 1946 sprengt ein Kommando der Gruppe „Irgun“ das „King David Hotel“ in Jerusalem in die Luft. Bei dem Sprengstoffattentat auf das Hotel, dem Sitz mehrerer Abteilungen der britischen Mandatsverwaltung, kommen 91 Menschen ums Leben.
MUSIK aus
Erzählerin
Am 14. Mai 1948 verlässt der letzte britische Hochkommissar Sir Alan Cunningham Palästina. Einige Stunden nach dem Ende des britischen Mandats tritt der jüdische Volksrat im Stadtmuseum von Tel Aviv zusammen. Wo David Ben Gurion unter dem Porträt Theodor Herzls die Proklamation des Staates Israel verliest.
14.O-Ton (nochmal O-Ton Ben Gurion)
Erzähler
Mit der Gründung des Staates Israels wird Theodor Herzls Vision eines jüdischen Staates in Palästina Wirklichkeit. Nur wenige Stunden nach der Proklamation erkennen die USA und die Sowjetunion den neuen Staat an. Gudrun Krämer:
15.O-Ton:
Aus zionistischer Sicht war das der Erfolg, den man herbeigesehnt hatte und den man mit allen Mitteln zu verteidigen gewillt war. Wenig überraschend ist auch die Reaktion auf arabischer Seite, wo selbstverständlich die Gründung dieses Staates als Desaster empfunden wurde. Zumal er sich verband nicht mit der Gründung eines palästinensisch-arabischen Staates, sondern der Vertreibung von etwa 700.000 Arabern aus dem nun jüdischen Staat. und daher das, was man im arabischen als „Nakba“ kennt, also die Katastrophe.
MUSIK
Erzählerin
Am Tag nach der Staatsgründung wird Israel von den umliegenden arabischen Staaten angegriffen und muss sich gegen die Armeen Ägyptens, Transjordaniens, Syriens, des Libanon und des Irak zur Wehr setzen. Was mithilfe von Waffen aus dem Ausland gelingt. Der erste Nahostkrieg endet 1949 mit dem Sieg Israels. Ein Erfolg, durch den sich der noch junge Staat etabliert.
MUSIK aus
TC 23:14 – Outro
304 episodes
Manage episode 417484673 series 2902670
Am 14.05.1948 endet das britische Mandat über Palästina. Noch am gleichen Nachmittag ruft David Ben Gurion den unabhängigen Staat Israel aus. Damit geht der Wunsch vieler Jüdinnen und Juden in Erfüllung, nach den letzten Jahrzehnten der Verfolgung und Ermordung zurückkehren zu können nach Zion, dem "Land der Väter". Der Weg von der Idee Theodor Herzls, in Palästina eine "Heimstätte" für das jüdische Volk zu schaffen, bis zum Staat Israel war lang. Von Beginn an war er von Konflikten und Interessenskollisionen bestimmt. Von Ulrike Beck (BR 2018)
Credits
Autorin: Ulrike Beck
Regie: Sabine Kienhöfer
Es sprachen: Hemma Michel, Christian Baumann, Johannes Hitzelberger
Technik: Miriam Böhm
Redaktion: Thomas Morawetz
Im Interview: Prof. Gudrun Krämer, Peter Lintl
Ein besonderer Linktipp der Redaktion:
BR24: Lost in Nahost – Der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza
Der Konflikt im Nahen Osten ist kompliziert. Es ist schwer den Überblick zu behalten. Was werfen die gegnerischen Seiten einander vor? Warum wird so hart gekämpft? In diesem Podcast haben die Korrespondent:innen der ARD aus dem Studio Tel Aviv und Expert:innen aktuelle Fragen beantwortet, erklärt und eingeordnet. ZUM PODCAST
Und hier noch ein paar besondere Tipps für Geschichts-Interessierte:
Im Podcast „TATORT GESCHICHTE“ sprechen die Historiker Niklas Fischer und Hannes Liebrandt über bekannte und weniger bekannte Verbrechen aus der Geschichte. True Crime – und was hat das eigentlich mit uns heute zu tun?
DAS KALENDERBLATT erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum - skurril, anrührend, witzig und oft überraschend.
Und noch viel mehr Geschichtsthemen, aber auch Features zu anderen Wissensbereichen wie Literatur und Musik, Philosophie, Ethik, Religionen, Psychologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Natur und Umwelt gibt es bei RADIOWISSEN.
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de.
Alles Geschichte finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Alles Geschichte
JETZT ENTDECKEN
Timecodes (TC) zu dieser Folge:
TC 00:15 – Intro
TC 02:02 – Der Vater des Zionismus
TC 06:43 – Eine Geschichte jüdischer Zuwanderung
TC 10:07 – Zwischen den Stühlen
TC 12:49 – Ein Ende der Zurückhaltung
TC 15:13 – Die UN und das „Palästinaproblem“
TC 19:36 – (K)eine Lösung?
TC 23:14 – Outro
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
TC 00:15 – Intro
1.O-Ton ( David Ben Gurion - unter dem Text weiterlaufen lassen)
Nicht übersetzt: Proklamation Ben Gurion
Erzähler
Israels erster Ministerpräsident David Ben Gurion ruft am 14. Mai 1948 den unabhängigen Staat Israel aus.
O-Ton aus
Nur wenige Stunden nach dem Ende des britischen Mandats über Palästina. Damit geht für viele Juden der Wunsch in Erfüllung, nach den Jahrzehnten der Verfolgung und Ermordung nun nach Zion, in das „Land der Väter“ zurückkehren zu können.
MUSIK
Erzählerin
Die Sehnsucht nach einer Rückkehr ins „verheißene Land“ ist nicht neu. Sie ist so alt wie das fast zweitausendjährige Exil nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem 70 n. Chr. und der Vertreibung der Juden aus Palästina. Die Idee, in Eretz Israel, dem "Land Israel" einen israelischen Staat zu gründen, ist allerdings noch jung.
Erzähler
Sie entsteht Ende des 19.Jahrhunderts mit dem Aufkommen des Zionismus. Was darunter zu verstehen ist, erklärt die Historikerin und Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer:
MUSIK aus
2.O-Ton: (Krämer ab 0:01)
Im weitesten Sinne die Sehnsucht nach Zion. Ein Alternativbegriff zu Jerusalem. Das kann religiös und kulturell sein. Es kann sich aber auch politisch zuspitzen. Ist dann eine Ausprägung des Nationalismus, wie er sich im 19.Jahrhundert in ganz vielen Formen herausbildete. Und beschreibt im konkreten Fall den jüdischen Nationalismus, der davon ausgeht, dass die Juden nicht nur eine religiöse Gemeinschaft sind, sondern auch eine politische und als solche auch den Anspruch besitzen, den andere Völker haben: die Bildung eines eigenen Staates.
TC 02:02 – Der Vater des Zionismus
MUSIK
Erzählerin
Als Vater des politischen Zionismus gilt Theodor Herzl. Ein jüdischer Intellektueller aus Wien, der ab 1891 als Korrespondent für die Zeitung „Neue Freie Presse“ in Paris arbeitet. Unter dem Eindruck der Affäre um Alfred Dreyfus, der als Hauptmann jüdischer Herkunft wegen angeblicher Militärspionage verbannt wird und zwei Jahre später trotz erwiesener Unschuld verurteilt bleibt, besteht für Herzl Handlungsbedarf.
Erzähler
Als Antwort auf den wachsenden Antisemitismus schreibt Herzl sein Buch „Der Judenstaat“, das zum Manifest für die Selbstbestimmung in einer eigenen Nation werden soll. Darin heißt es:
MUSIK aus
Zitator: (Herzl S. 4)
„Ich halte die Judenfrage weder für eine soziale, noch für eine religiöse. Sie ist eine nationale Frage und um sie zu lösen, müssen wir sie zu einer politischen Weltfrage machen, die im Rate der Kulturvölker zu regeln sein wird.“
MUSIK
Erzählerin
Die von Herzl angesprochene „Judenfrage“ ist spätestens seit 1881 - nach dem Attentat auf den russischen Zaren Alexander II. - von existentieller Wichtigkeit. Obwohl die Täter der extremistischen Organisation „Narodnaja Wolja“, übersetzt „Volkswille“, angehören, wird die Schuld zunächst „den“ Juden angelastet. In der Folge kommt es bereits ab 1881 zu einer ersten Welle von Pogromen in Russland und in Polen. Wie mit dieser Situation umgehen? Der Politikwissenschaftler Peter Lintl:
MUSIK aus
3.O-Ton (Lintl ab 1:03)
Für die Genese des Zionismus (…) ganz zentral ist sicherlich der europäische Antisemitismus und die Frage - was in Europa als die sogenannte „jüdische Frage“ bezeichnet wird. Nämlich: Was soll man mit den Juden in Europa machen? Darauf gab es im Judentum auch unterschiedliche Antworten. Zum einen in West- und Zentraleuropa den Versuch, sich zu integrieren und zu akkulturieren, manchmal auch zu assimilieren, d.h. durch größtmögliche Anpassung die Judenfeindschaft zurückzudrängen. In Osteuropa war es eher das Anhängen an der Tradition. (…) da herrschte auch die Hoffnung vor, dass einfach durch Gottvertrauen der Antisemitismus als Phänomen in der Geschichte vorbei gehen würde. Der Zionismus hingegen sagt: Nein, die jüdische Frage kann nicht in Europa gelöst werden, sondern wir müssen unser Schicksal in unsere eigenen Hände nehmen und wir müssen unseren eigenen Staat gründen.
Erzähler
„Der Judenstaat“ erscheint am 14.Februar 1896 in Wien und wird in 18 Sprachen übersetzt. Darin entwirft Theodor Herzl ein Programm, wie es gelingen kann, einen Staat für das jüdische Volk zu schaffen. Als künftige Landessprache erscheint ihm Deutsch geeigneter, als das alttestamentarische Hebräisch. Als passenden Ort favorisiert er neben Palästina auch Argentinien. Gudrun Krämer:
4.O-Ton: (Krämer ab 0:56)
Theodor Herzl war ein bürgerlicher Aktivist. Ein Journalist, der in ganz rechtlichen Bahnen dachte und als Voraussetzung für den Erfolg annahm, dass die (…) führenden europäischen Länder, bzw. Staaten plus die USA diese Idee eines jüdischen Staates unterstützen müssten. So dass hier nicht quasi wild Kolonien und Siedlungen errichtet würden, sondern dass von vornherein eine internationale Gemeinschaft hinter diesem Plan stünde und darauf dringen könnte, in Eretz Israel, also Palästina, oder auch an anderem Orte, einen wohlgeordneten jüdischen Staat entstehen zu lassen.
Erzählerin
Am 3.September 1897 gründet sich auf Initiative Herzls die Zionistische Weltorganisation. Auf ihrem ersten Kongress in Basel verabschiedet die ZWO ihr Grundsatzprogramm. Mit dem zentralen Ziel der „Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina“. Jetzt war also klar - es sollte um Palästina gehen.
Erzähler
Doch um dieses Ziel zu erreichen, braucht Theodor Herzl als Präsident der Zionistischen Weltorganisation Unterstützung. Was angesichts des wachsenden Antisemitismus in Europa ein Problem ist. Gudrun Krämer:
5.O-Ton:
Er hatte nicht die Unterstützung der Regierungen, wie viele Teile auch der jüdischen Bevölkerung dieser Idee sehr skeptisch gegenüber standen, nicht so recht sehen konnten, wohin die Reise gehen würde. Er hatte Zuspruch unter jüdischen Gemeinschaften in Osteuropa, obwohl er selber ausgesprochen westeuropäischer Jude war und sich auch in erster Linie an die westeuropäischen jüdischen und nichtjüdischen Eliten richtete. Aber der Druck auf Juden war in Osteuropa stärker als in Westeuropa und daher auch die Zustimmung in jener Zeit der noch recht unspezifischen Idee eines jüdischen Staates.
TC 06:43 – Eine Geschichte jüdischer Zuwanderung
MUSIK
Erzählerin
Die ersten jüdischen Zuwanderer kommen bereits 1882 nach Palästina. Es sind rund 30.000 osteuropäische Juden, die vor allem wegen der antisemitischen Übergriffe in Russland und Polen auswandern. Sie kommen in ein Land, das damals Teil des Osmanischen Reiches ist:
MUSIK aus
Palästina.
MUSIK
Erzähler
Das Land ist keineswegs unbewohnt. 350.000 Menschen leben hier. Die überwiegende Mehrheit sind Araber sunnitisch-muslimischen Glaubens. Neben ihnen gibt es auch eine große christliche Gemeinschaft und gläubige Juden.
AKZENT Glockengeläut Muezzin
Erzählerin
Die Bewohner Palästinas sind Ende des 19.Jahrhunderts vor allem im Süden des Landes sesshaft. Die meisten von ihnen sind Bauern.
Erzähler
In den Städten leben Handwerker, Kaufleute, Unternehmer und die lokale Oberschicht, Notabeln genannt. Außer der Hauptstadt Jerusalem sind vor allem die Hafenstädte Haifa und Jaffa bedeutend, ebenso wie die Bergstadt Nablus.
MUSIK
Erzählerin
Für die Bewohner Palästinas ändert sich mit den neuen Zuwanderern viel. Denn mit der sogenannten zweiten Alija, der zweiten Einwanderungswelle kommen ab 1903 rund 40.000 weitere jüdische Einwanderer, die vor den erneuten Pogromen in Russland und Polen fliehen. Und sich daran machen, auf dem Land Boden zu kaufen, um dort nach sozialistischem Vorbild in Produktionsgemeinschaften Landwirtschaft zu betreiben. Peter Lintl:
6.O-Ton:
Insbesondere die zweite und die dritte Alija war sozialistisch geprägt. Das sieht man nicht nur an den Kibbuzim und Mosharim, also basisdemokratischen Kollektiven, die quasi ohne individuelles Eigentum oder mit sehr wenig individuellem Eigentum auskamen, aber vielmehr sieht man das auch noch in den Idealen, die die zionistische Bewegung der Zeit prägten. Also da war das Ideal des unabhängigen, heroischen Pioniers, des Haluts, des neuen Hebräers, der sein Land - Eretz Israel - bearbeitet und sich damit auch zu eigen macht. Das drückt sich z.B. sehr deutlich in der Formel „Erlösung des Landes durch die Eroberung des Bodens“ aus. Dazu kommt auch das Prinzip der hebräischen Arbeit. Man wollte unabhängig sein von arabischen Arbeitern und wollte alles selbst erarbeiten.
Erzähler
Die jüdischen Zuwanderer verwenden moderne Technologien, um den Boden zu bearbeiten und zu bewässern. Sie bauen Zitrusfrüchte an, die für den Export bestimmt sind. Die meisten von ihnen leben allerdings nicht auf dem Land, sondern lassen sich in den Städten nieder. Sie brauchen Platz. 1909 entsteht neben der alten Hafenstadt Jaffa die heutige Millionenmetropole Tel Aviv.
Erzählerin
Schon bald beginnen die jüdischen Bewohner Palästinas sich zu organisieren. Sie gründen nicht nur Vereine, Verbände und Clubs, sondern errichten auch Bibliotheken und das Technion in Haifa - die erste Universität.
Mit Gründung der Gewerkschaftsorganisation Histadrud schaffen sie sich einen eigenen Arbeitsmarkt. Und organisieren zum Schutz ihrer Siedlungen Wächter, die Schomreen.
Erzähler
Zwischen der arabischen Bevölkerung und den jüdischen Zuwanderern bilden sich in dem kleinen Land Parallelgesellschaften heraus.
MUSIK
TC 10:07 – Zwischen den Stühlen
Erzählerin
Bis 1917 steht Palästina unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches. Doch gegen die Osmanen formiert sich schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts die nationalarabische Bewegung. Ihr Ziel ist ein unabhängiges Vereinigtes Arabisches Königreich, das neben Palästina auch Syrien, den Libanon und Jordanien umfassen soll.
Erzähler
Ein Plan, der nicht aufgeht, denn im Ersten Weltkrieg erhöht sich der Stellenwert Palästinas für die europäischen Großmächte.
MUSIK aus
Großbritannien erobert das Land und erhält 1922 das Mandat über Palästina. Peter Lintl:
7.O-Ton
Zunächst ist für Großbritannien Palästina strategisch wichtig. Der Zugang zum Suezkanal ist eine Sache. Ist ein Teil der Landbrücke nach Indien und alle Wege nach Indien sind für das britische Empire zur Zeit des Kolonialismus einfach zentral. In Palästina wird Großbritannien tatsächlich vor eine Herausforderung gestellt, weil es klar ist, dass es zwei verschiedenen Interessen gerecht werden muss. Einmal der palästinensischen Seite, die dort einen Staat errichten will.
Zumindest im Laufe der Zeit kristallisiert sich der palästinensische Nationalismus immer klarer heraus. Und auf der anderen Seite dem Zionismus, der das ähnliche Ziel hat oder das nämliche. Deswegen spricht man von der doppelten Verpflichtung der Briten, der dual Obligation, die sie zu erfüllen hat.
Erzählerin
Schon rund fünf Jahre zuvor, am 2.November 1917, schreibt der britische Außenminister Lord Arthur Balfour an den Vorsitzenden der Zionistischen Vereinigung in England einen Brief, der als „Balfour-Erklärung“ von zentraler Bedeutung sein wird. Darin verspricht Balfour Lord Lionel Walter Rothschild:
Zitator:
"Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei, wohlverstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte."
8.O-Ton: ( Krämer ab ca. 15:15)
Dieses Versprechen, das zunächst keine völkerrechtlich bindende Funktion hatte, wurde in den Mandatsvertrag übernommen, bzw. in dessen Präambel und erhielt dadurch ein ganz anderen rechtlichen Status. Hinzu kam aber eine Verpflichtung, die Großbritannien als Mandatsmacht gegenüber der lokalen Bevölkerung - mehrheitlich arabisch - sie bereit zu machen für die Übernahme politischer Verantwortung. In letzter Konsequenz für die Unabhängigkeit. Und wie sich herausstellen sollte, konnte man nicht beiden Seiten gerecht werden.
TC 12:49 – Ein Ende der Zurückhaltung
MUSIK
Erzähler
Ab 1919 kommen mit der dritten und vierten Alija 115.000 jüdische Zuwanderer nach Palästina. Es sind so viele, dass die arabische Bevölkerung befürchtet, bald in der Minderheit zu sein. Es kommt zu ersten blutigen Ausschreitungen, die sich ab 1920 zunächst gegen die Zionisten richten, bald jedoch auch gegen die britischen Mandatsbehörden. Der Konflikt führt dazu, dass sich die jüdischen Einwanderer militarisieren. Die jüdische Armee, die „Hagana“ formiert sich. Peter Lintl:
MUSIK aus
9.O-Ton:
Bis dato war eigentlich das Prinzip der Zurückhaltung - geprägt noch von einem jüdischen Quiezismus noch aus der Exilszeit zu sehen, aber danach mit der weiteren Eskalation des Konflikts kann man sehen, wie sich auch der Zionismus Stück für Stück militarisiert. Grundsätzlich ist natürlich der Konflikt: Wem gehört das Land? Und über diesen Konflikt kommt es zu mehreren Ausbrüchen von Gewalt. Ganz bekannt ist 1920/21, dann 1929 und dann zum größeren palästinensischen Aufstand 1936 bis '39, der dann von den Briten relativ blutig niedergeschlagen wird.
Erzählerin
Um die zunehmende Eskalation der Gewalt zwischen beiden Seiten einzudämmen, machen die britischen Mandatsträger im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges der arabischen Seite Zugeständnisse. Mit dem MacDonald-Weißbuch beschränkt Großbritannien im Mai 1939 die Einwanderung von Juden auf 75.000 für die nächsten fünf Jahre. Gudrun Krämer:
10.O-Ton:
Die Konsequenzen waren von vornherein abzusehen. Die Briten banden die Zahl der Zuwanderer an die Aufnahmefähigkeit des arabischen Sektors - so war die Formulierung, also zunächst einmal an die wirtschaftlichen Möglichkeiten.
Setzten aber noch eins drauf, indem sie auch die politische Willigkeit der arabischen Bevölkerung mit in Rechnung nahmen. Und die Konsequenz war ganz klar, dass dieses die Zuwanderungsmöglichkeit der jüdischen Zuwanderer nach Palästina begrenzte. In einer Zeit, in der durch den Antisemitismus und die Judenverfolgung in großen Teilen Europas der Druck auf die jüdischen Bewohner Europas wuchs, sich eine Alternative zu suchen, also auszuwandern. Darunter auch nach Palästina.
TC 15:13 – Die UN und das „Palästinaproblem“
Erzähler
Bis über das Ende des Zweiten Weltkrieges hinaus versucht der britische Mandatsträger, europäische Juden daran zu hindern, in Palästina einzuwandern. Dennoch ist die Zahl der illegalen Immigranten in der Zeit der NS-Diktatur hoch. Rund 75.000 schaffen es, trotz der restriktiven Politik, nach Palästina zu kommen.
MUSIK
Erzählerin
Als Exempel gegen die illegale Einwanderung wird zwei Jahre nach dem Ende des Holocaust die Odyssee des Schiffes „Exodus“ weltweit bekannt. Das Schiff steuert im Juli 1947 mit über 4.000 jüdischen KZ-Überlebenden an Bord den Hafen von Haifa an. 20 Meilen vor der Küste wird die „Exodus“ von britischen Kriegsschiffen angegriffen. Die Passagiere werden im Hafen auf drei britische Gefängnisschiffe verteilt und nach Frankreich zurückgeschickt.
Erzähler
Dort weigern sie sich, an Land zu gehen. Die Odyssee geht weiter - über Gibraltar nach Hamburg. Wo die jüdischen Flüchtlinge mit Gewalt von Bord geholt und in Lagern untergebracht werden. Gesichert mit Wachtürmen und Stacheldraht.
Unter dem Druck der weltweiten Empörung kommen die Passagiere der „Exodus“ im Oktober 1947 frei.
MUSIK aus
Erzählerin
Schon Monate vor dem Drama der „Exodus“ sieht sich die Mandatsmacht Großbritannien nicht mehr in der Lage, sowohl für den jüdischen, als auch für den arabischen Teil der Bevölkerung in Palästina eine annehmbare Lösung zu finden. Daher beschließt die britische Regierung am 14. Februar 1947, das „Palästinaproblem“ an die Vereinten Nationen zu übergeben.
MUSIK
Erzähler
Damit übernehmen die 1945 gegründeten Vereinten Nationen als Nachfolger des Völkerbundes die Aufgabe, eine Lösung für die politische Zukunft Palästinas zu finden. Sie setzen eine Sonderkommission ein, das „United Nations Special Committee on Palestine“, kurz: UNSCOP.
Erzählerin
Das in seinem Bericht den Plan vorlegt, Palästina zu teilen.
MUSIK aus
In einen jüdischen Staat, bestehend aus 56 Prozent des Territoriums. Und einen arabischen Staat, bestehen aus 43 Prozent des Territoriums. Jerusalem mit seiner zentralen Bedeutung für Juden, Christen und Muslime soll als internationales Gebiet neutral bleiben.
Erzähler
Am 29.November 1947 stimmt die UN-Vollversammlung mit der Resolution 181 dafür, Palästina zu teilen und das britische Mandat aufzuheben.
11.O-Ton ( UN-Vollversammlung)
Erzählerin
Gegen die Resolution stimmen nicht nur Afghanistan, Ägypten, Iran, Irak, Jemen, Libanon und Pakistan, sondern auch Griechenland, Indien und Kuba
MUSIK
Erzähler
Für den Fall der Verwirklichung des Teilungsplanes kündigt die 1945 gegründete Arabische Liga bereits im Vorfeld an, militärische Maßnahmen zu ergreifen und eine „Arabische Befreiungsarmee“ aufzustellen. Unmittelbar nach dem UN-Beschluss kommt es in Palästina zu erbitterten Gefechten zwischen arabischen und jüdischen Militäreinheiten. Am 1. April 1948 beginnt der Plan Dalet. Eine Offensive der Hagana, der jüdischen Armee. Gudrun Krämer:
MUSIK aus
12. O-Ton:
Die Kommission der Vereinten Nationen hatte nach sorgsamer Betrachtung der Realitäten zwei Staaten vorgeschlagen, die jeweils aus nur lose miteinander verknüpften kleinen Territorien bestehen würde. Und hatte dabei der jüdischen Seite dabei mehr Land zugesprochen, als zu dieser Zeit von Juden rechtlich besessen war. Also erworben, gekauft worden war. (…) Das war natürlich konfliktträchtig. Und der Plan Dalet, Plan D., lief nun darauf hinaus, das Land, das die Vereinten Nationen den Juden zugesprochen hatte, auch tatsächlich militärisch zu kontrollieren. Also gewissermaßen im Vorgriff auf die Ausrufung des jüdischen Staates bereits Realitäten zu schaffen. Und dieses war nur möglich durch Anwendung von Gewalt.
TC 19:36 – (K)eine Lösung?
MUSIK
Erzählerin
Im Laufe der Militäroffensive kommt es am 9. April 1948 zum Massaker im arabischen Dorf Deir Yassin, bei dem 250 Menschen ermordet werden.
Die meisten davon sind Frauen und Kinder. Verantwortlich für das Massaker sind die extremistischen Untergrundorganisationen Lehy und Irgun, die damit die arabische Bevölkerung einschüchtern und vertreiben wollen. Peter Lintl:
MUSIK aus
13.O-Ton:
Das Massaker von Deir Yassin wurde verübt von zwei Organisationen und die hatten ganz offensichtlich das Ziel, das Dorf zu säubern. Die Hagana selbst, also die Hauptverteidigungsarmee der Zionisten, hatte damit nichts zu tun und hat dieses Massaker auch verurteilt. Gleichwohl auch die Hagana hat dann in Flugblättern, die dann über Haifa abgeworfen worden sind, Andeutungen gemacht, dass es dieses Massaker gegeben hätte und hat das dann ein Stück weit instrumentalisiert. Sie wollten nicht sagen, dass sie das auch verüben, aber damit Furcht geschürt. Umgekehrt hat der jüdische Bürgermeister von Haifa die Araber, die daraufhin geflohen sind, aufgerufen, hier zu bleiben.
MUSIK
Erzähler
Die radikalen Kampforganisationen „Irgun“ und „Lehi“ verüben auch Attentate gegen britische Verwaltungseinrichtungen und Politiker. Am 22. Juli 1946 sprengt ein Kommando der Gruppe „Irgun“ das „King David Hotel“ in Jerusalem in die Luft. Bei dem Sprengstoffattentat auf das Hotel, dem Sitz mehrerer Abteilungen der britischen Mandatsverwaltung, kommen 91 Menschen ums Leben.
MUSIK aus
Erzählerin
Am 14. Mai 1948 verlässt der letzte britische Hochkommissar Sir Alan Cunningham Palästina. Einige Stunden nach dem Ende des britischen Mandats tritt der jüdische Volksrat im Stadtmuseum von Tel Aviv zusammen. Wo David Ben Gurion unter dem Porträt Theodor Herzls die Proklamation des Staates Israel verliest.
14.O-Ton (nochmal O-Ton Ben Gurion)
Erzähler
Mit der Gründung des Staates Israels wird Theodor Herzls Vision eines jüdischen Staates in Palästina Wirklichkeit. Nur wenige Stunden nach der Proklamation erkennen die USA und die Sowjetunion den neuen Staat an. Gudrun Krämer:
15.O-Ton:
Aus zionistischer Sicht war das der Erfolg, den man herbeigesehnt hatte und den man mit allen Mitteln zu verteidigen gewillt war. Wenig überraschend ist auch die Reaktion auf arabischer Seite, wo selbstverständlich die Gründung dieses Staates als Desaster empfunden wurde. Zumal er sich verband nicht mit der Gründung eines palästinensisch-arabischen Staates, sondern der Vertreibung von etwa 700.000 Arabern aus dem nun jüdischen Staat. und daher das, was man im arabischen als „Nakba“ kennt, also die Katastrophe.
MUSIK
Erzählerin
Am Tag nach der Staatsgründung wird Israel von den umliegenden arabischen Staaten angegriffen und muss sich gegen die Armeen Ägyptens, Transjordaniens, Syriens, des Libanon und des Irak zur Wehr setzen. Was mithilfe von Waffen aus dem Ausland gelingt. Der erste Nahostkrieg endet 1949 mit dem Sieg Israels. Ein Erfolg, durch den sich der noch junge Staat etabliert.
MUSIK aus
TC 23:14 – Outro
304 episodes
All episodes
×Welcome to Player FM!
Player FM is scanning the web for high-quality podcasts for you to enjoy right now. It's the best podcast app and works on Android, iPhone, and the web. Signup to sync subscriptions across devices.